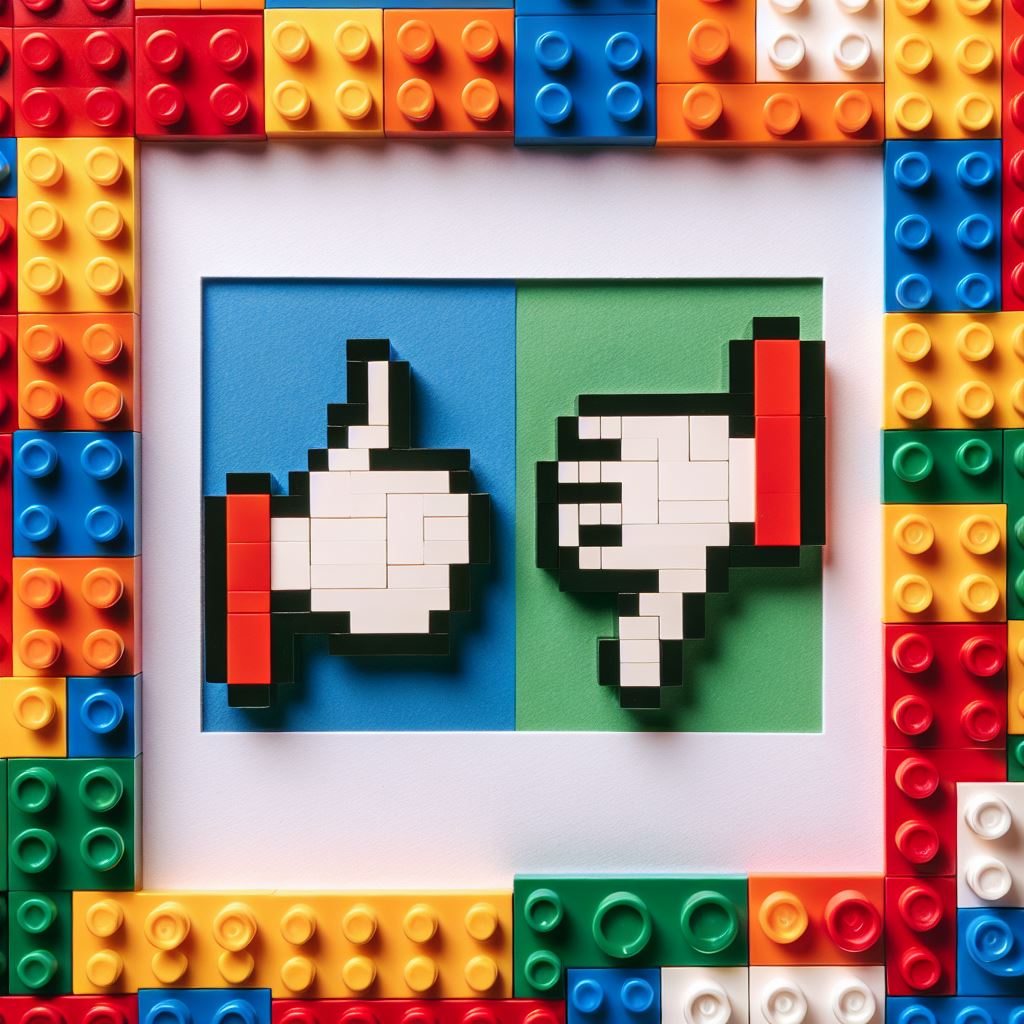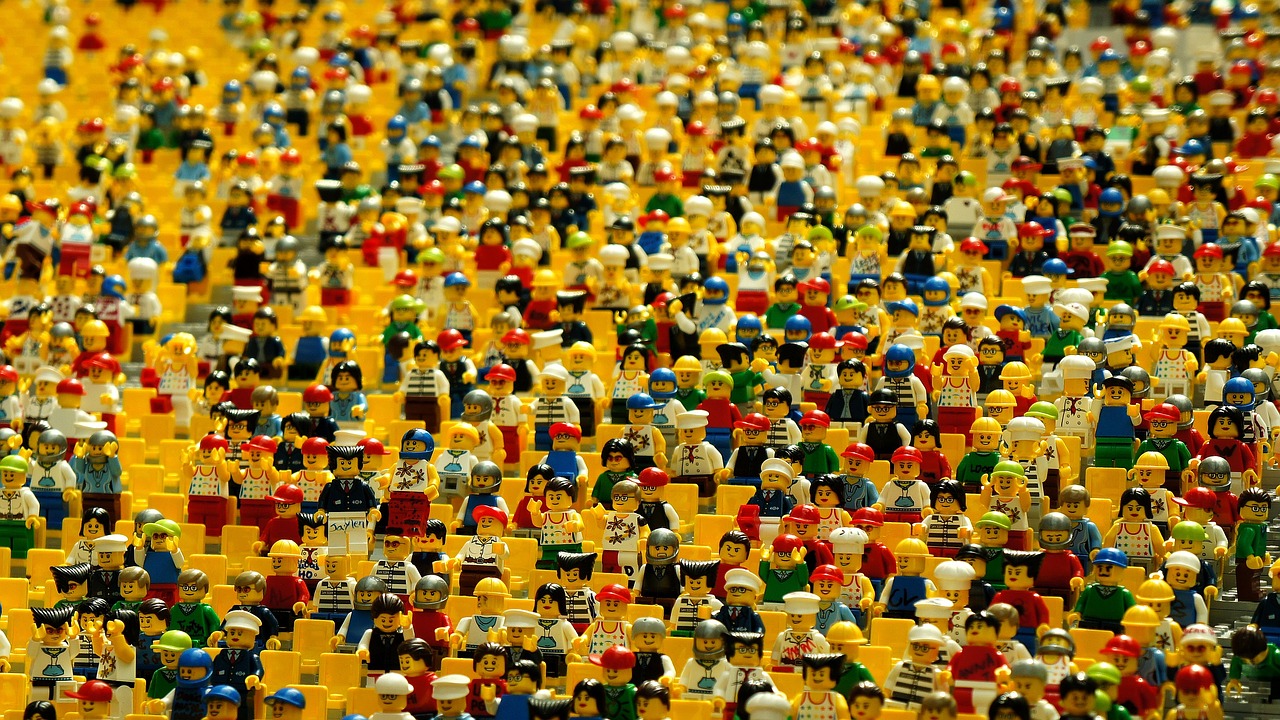LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) lebt davon, dass jemand den Raum hält, gute Fragen stellt und für Struktur sorgt. Ohne diese Moderation+ bleibt es oft bei ein paar nett gebauten Modellen – und bei Teilnehmern, die sich fragen, was das Ganze eigentlich sollte. Doch was passiert, wenn die Moderation selbst zum Problem wird? Wenn der Facilitator zu viel will, zu wenig bietet oder sich an die Methode klammert wie ein Bürokrat ans Regelbuch?
In diesem Beitrag geht’s um die Macht, die mit der Moderation einhergeht – und um die Schattenseiten, die gern übersehen werden. Nicht zur Abschreckung. Sondern zur Orientierung.
![LEGO Facilitator [Bild von kirill_makes_pics auf Pixabay]](https://pierresmits.de/wp-content/uploads/2025/05/bunny-3830669_1280.jpg)
Inhalt
Einstieg: Die unsichtbare Hand im Spiel
Stell dir eine Runde mit fünf Personen vor. Jeder bekommt einen kleinen Haufen LEGO-Steine, ein paar Minuten Zeit und die Aufgabe: „Bau, was für dich gute Zusammenarbeit bedeutet.“
Alle fangen an. Ein paar bauen konzentriert vor sich hin. Einer fragt nach. Einer baut einfach irgendwas. Und den Facilitator kümmert es nicht.
Dann kommt die nächste Runde. Jetzt heißt es: „Bau, was dein größtes Hindernis im Projektalltag ist.“
Einer fragt wieder nach – „Darf ich auch Figuren benutzen?“
Der Facilitator sagt: „Eigentlich nicht vorgesehen.“
Aha! Und jetzt?
Wenn man genau hinschaut, merkt man: LEGO SERIOUS PLAY (LSP) funktioniert nicht von allein. Es braucht jemanden, der anleitet, der Fragen gut stellt, der Raum gibt, der steuert, ohne zu lenken. Klingt widersprüchlich? Ist es manchmal auch.
Denn genau da liegt die Krux: Der Facilitator ist so wichtig wie unauffällig. Wenn’s gut läuft, merkt man kaum, wie sehr die Moderation den Verlauf prägt. Wenn’s schiefläuft, fragt man sich: Wer hat hier eigentlich das Steuer in der Hand?
![LEGO Bauarbeiter [Bild von Armando are auf Pixabay]](https://pierresmits.de/wp-content/uploads/2025/05/lego-5884583_1280-1024x681.jpg)
Die zentrale Rolle des Facilitators – Stärke oder Schwäche?
LEGO SERIOUS PLAY (LSP) läuft nicht einfach von selbst. Es ist kein Workshop, bei dem du ein Thema nennst und hoffst, dass sich die Leute schon melden. Diese Methode braucht jemanden, der den Prozess aktiv gestaltet – mit klugen Fragen, einem durchdachten Aufbau und der richtigen Menge an Anleitung.
Ohne diesen roten Faden wird aus einem ernsthaften Denkprozess schnell ein bunter Kindergeburtstag – oder etwas Schlimmes: betretenes Schweigen, weil niemand so recht weiß, was er eigentlich bauen soll. Oder warum.
Der Facilitator sorgt dafür, dass aus den Steinen echte Erkenntnisse werden. Dass auch die ruhigeren Teilnehmer zu Wort kommen. Dass nicht nur der Lauteste den Ton angibt. Und dass der rote Faden nicht nach fünf Minuten auf mysteriöse Weise verschwindet. Kurz gesagt: Ohne diese Rolle funktioniert LSP nicht. Sie macht den Unterschied zwischen „war ganz nett“ und „das hat uns wirklich weitergebracht“.
Aber wie bei allem hat diese zentrale Rolle auch ihre Schattenseite.
![LEGO Star Wars [Bild von kirill_makes_pics auf Pixabay]](https://pierresmits.de/wp-content/uploads/2025/05/lego-2539844_1280-1024x683.jpg)
Denn je mehr eine Methode von einer einzigen Person abhängt, desto größer ist das Risiko. Wenn die Moderation nicht sitzt – sei es zu unsicher, zu dominant oder zu technokratisch – dann bricht alles zusammen oder läuft völlig ins Leere.
Die spannende Frage ist also nicht nur: Wie wichtig ist der Facilitator?
Sondern auch: Was passiert, wenn er oder sie der Rolle nicht gerecht wird?
Schattenseiten der Facilitator-Zentrierung
Ein guter Facilitator ist Gold wert – aber manchmal kann es auch ziemlich schiefgehen, wenn diese Rolle zu dominant, zu starr oder einfach unreflektiert ausgefüllt wird. Hier ein paar Klassiker, die immer wieder vorkommen:
![LEGO Facilitator Dunkle Seite [Bild von Stephan Wusowski auf Pixabay]](https://pierresmits.de/wp-content/uploads/2025/05/star-wars-5213604_1280-1024x682.jpg)
1. Der Dogmatiker: „Das muss so.“
Es gibt Facilitatoren, die gehen mit dem Handbuch um wie ein Beamter mit seiner Stempelkarte. Jede Abweichung vom Standardprozess ist für sie ein Verstoß gegen die heiligen Regeln. Wenn dann jemand fragt: „Können wir das auch anders machen?“ kommt nicht etwa ein nachdenkliches „Hmmm, vielleicht…“, sondern gleich das Zitat aus der Vorschrift. Oder sogar eine ganz eigene Interpretation.
Problem: Die Methode soll dazu da sein, Denkprozesse zu fördern – und nicht, sie festzulegen. Wenn alles nur nach Plan läuft, ist von Kreativität schnell nichts mehr übrig. Dann ist es nicht mehr ein flexibler Prozess, sondern eher eine LEGO-Anleitung, die man einfach abarbeitet.
2. Der Selbstdarsteller: „Ich zeig euch mal, wie’s geht.“
Manche Facilitator verwechseln ihre Rolle mit einer Showbühne. Da wird dann selbst gebaut, erzählt, interpretiert – als ginge es um eine TED-Talk-Generalprobe. Vor allem wenn es die Teilnehmer vermeintlich „falsch“ bauen oder interpretieren.
Solche Moderationen laufen selten gut. Denn wer den Raum für sich beansprucht, nimmt ihn den anderen weg. Und LSP lebt davon, dass alle bauen, erzählen und zuhören – nicht davon, dass einer glänzt.
3. Der Unsichtbare: „Ihr macht das schon.“
Am anderen Ende der Skala steht der Facilitator, der sich völlig zurückzieht. Kaum Anleitung, keine Struktur, Fragen wie „Was fällt euch so ein?“ – und am Ende steht eine Gruppe, die sich im Nebel verliert.
Klar, Selbstorganisation ist wichtig. Aber nur, wenn alle wissen, worum es geht. Ohne klare Orientierung wird der Prozess beliebig – und jeder baut irgendwas, aber keiner weiß so recht, was der ganze Kram bringen soll.
4. Der Beeinflusser: „Findet mal bitte selbst heraus, dass ich recht habe.“
Besonders tricky: Facilitator, die ihre eigenen Überzeugungen oder Ziele hinter den Kulissen einfließen lassen. Das passiert oft ganz subtil – durch die Art, wie Fragen gestellt werden, wie Beiträge zusammengefasst werden oder welche Punkte besonders betont werden.
Diese „moderierten Meinungen“ sind schwer zu erkennen, aber sie verändern den Prozess. Aus einem offenen Dialog wird ein gelenktes Theaterstück, mit dem Facilitator als heimlichem Regisseur.
All diese Schattenseiten haben eines gemeinsam: Sie zeigen, wie stark der Verlauf eines Workshops vom Facilitator abhängt – und wie diese Rolle sich schnell zur Schwachstelle entwickeln kann, wenn sie nicht richtig ausgefüllt wird.
Risiken und Symptome in der Praxis
Die besten Methoden helfen nichts, wenn sie nicht richtig wirken – und das merkt man meist ziemlich schnell. Auch bei LEGO SERIOUS PLAY. Oft liegt’s gar nicht an den Steinen, sondern an der Art und Weise, wie moderiert wird. Hier sind ein paar typische Symptome, an denen du erkennst, dass der Facilitator eher bremst als beflügelt:
🧱 Typische Warnzeichen in LSP-Workshops
- Unklarer Auftrag – alle bauen, keiner weiß wofür.
- Einzelne dominieren – oder alle schweigen.
- Schöne Modelle, null Erkenntnis.
- Ablauf schlägt Inhalt.
- Höfliche Stille statt Wirkung.
🛠️ Oft liegt’s nicht an der Methode – sondern an der Moderation.
![LEGO Figur – Risiko [Bild von Ralf Ruppert auf Pixabay]](https://pierresmits.de/wp-content/uploads/2025/05/lego-6571821_1280-1024x576.jpg)
Symptom 1: Alle bauen – aber keiner weiß, warum
Wenn die Aufgabenstellung zu vage oder voll von leeren Phrasen ist, dann wird zwar gebaut, aber nicht wirklich nachgedacht. Beispiel hierfür ist: „Gestaltet euer inneres Wertesystem im Spannungsfeld eurer Arbeitsrealität.“
Jeder hat eine andere Vorstellung, und am Ende steht ein Haufen bunter Modelle, die niemand wirklich versteht.
Symptom 2: Immer dieselben reden – oder gar keiner
Ein guter LSP-Workshop bringt alle ins Gespräch. Wenn jedoch der eine Dauersprecher die Runde dominiert und der Rest schweigt – oder wenn niemand etwas sagt, weil die Struktur fehlt –, dann läuft etwas schief. Der Dialog wird zur Ein-Mann-Show, und das Publikum schaut zu.
Symptom 3: Das Modell sieht super aus – aber keiner nimmt was mit
Ein schöner Turm. Ein schräges Männchen mit Helm. Vielleicht sogar ein kleines LEGO-Schwein. Und trotzdem: Null Aha-Moment. Kein Impuls für die Praxis. Das passiert, wenn das Bauen zum Selbstzweck wird – oder die Reflexion zu oberflächlich bleibt.
Symptom 4: Der Prozess ist wichtiger als das Thema
Wenn der Facilitator mehr auf den Timer schaut als auf die Leute im Raum, wird’s schwierig. Dann geht’s plötzlich nur noch darum, ob wir uns in Phase 2b oder schon in 3a befinden – nicht mehr darum, was eigentlich gesagt wird.
Am Ende hat man einen sauber durchgetakteten Workshop, bei dem alles gestimmt hat. Außer dem Inhalt. Und das nervt.
Symptom 5: Höfliche Gesichter – aber niemand redet mehr drüber
Das ist der Klassiker: Am Ende des Workshops bedanken sich alle artig. Die gebauten Modelle landen in einem Gruppenfoto. Es gibt ein paar Sätze wie „spannend“, „mal was anderes“ oder „interessant“. Und am Montag ist alles vergessen.
Spätestens dann lohnt sich die Frage: War es wirklich die Methode – oder doch die Art, wie sie angeleitet wurde?
Wege aus der Falle – was gute Moderation ausmacht
Es gibt kein Geheimrezept für den perfekten Facilitator. Und das ist auch gut so. Aber eine gute Ausbildung und ein paar einfache Prinzipien helfen, dass aus einem LEGO-Workshop mehr wird als nur ein bunter Bastelnachmittag. Es geht nicht darum, alles richtig zu machen – sondern einen Rahmen zu schaffen, in dem echte Gedanken entstehen können. Und vielleicht sogar ein bisschen Erkenntnis.
![LEGO Scout [Bild von Ralf Ruppert auf Pixabay]](https://pierresmits.de/wp-content/uploads/2025/05/lego-7135217_1280-1024x682.jpg)
1. Klar anleiten und strukturieren – ohne gewünschte Ergebnise vorzudenken / vorzugeben
Ein guter Facilitator sorgt für Orientierung, ohne den Leuten das Denken abzunehmen. Es geht nicht darum, Lösungen vorzukauen – sondern kluge Fragen zu stellen, die man sich gern beantwortet.
Beispiel gefällig?
Statt: „Bau deine Vision der Zukunft.“
Lieber: „Wie sieht euer Arbeitsalltag in zwei Jahren aus, wenn’s richtig gut läuft?“
Das ist konkreter, verständlicher – und trotzdem offen genug für eigene Ideen.
2. Mehr fragen, weniger wissen
Die besten Facilitatoren hören mehr zu, als sie reden. Und sie fragen lieber nach, als gleich eine Interpretation rauszuhauen:
Was bedeutet das für dich?
Was wäre, wenn du das Modell mal auf den Kopf stellst?
Was fehlt dir noch, damit es rund wird?
Gute Fragen öffnen Räume. Gute Antworten kommen dann von allein.
3. Unterschiedliche Perspektiven ermöglichen
Nicht jeder ist der geborene Vielredner. Und nicht jeder denkt im gleichen Takt. Eine gute Moderation sorgt dafür, dass nicht nur die Lautesten das Wort führen – sondern auch die Leisen, die Vorsichtigen und die mit den schrägen Ideen zu Wort kommen.
Dafür braucht’s manchmal gar nicht viel: Eine klare Runde, eine gezielte Frage – oder einfach mal den Perspektivwechsel à la „Was würde wohl ein Kunde sagen, wenn er das hier sieht?“
4. Mut zur Lücke
Nicht jeder Moment muss moderiert werden. Manchmal hilft es mehr, einfach mal nichts zu sagen. Den Raum wirken zu lassen. Die Gruppe selbst machen zu lassen.
Das ist nicht bequem. Aber oft genau der Moment, in dem etwas passiert.
Gute Moderation heißt manchmal auch: einfach mal aushalten, dass es kurz still ist.
5. Reflexion statt Ritual
Nur weil es im LEGO-Leitfaden steht, muss man’s nicht immer genauso machen. Gute Facilitatoren spüren, wann etwas passt – und wann nicht. Manchmal hat auch die beste Methode ihre Grenzen erreicht. Und sie haben kein Problem damit, spontan anzupassen.
Ein Workshop ist kein Kirchenritual. Und LEGO kein Sakrament. Man darf (und soll) denken – auch als Facilitator.
✅ Checkliste: Was gute Moderation bei LEGO SERIOUS PLAY ausmacht
🧭 Klar anleiten und strukturieren – ohne vorzudenken
☐ Aufgaben sind konkret, aber offen formuliert
☐ Es ist klar, was gebaut werden soll – nicht wie oder was dabei rauskommen muss
🗣️ Mehr fragen, weniger wissen
☐ Facilitator stellt offene, neugierige Fragen
☐ Keine vorschnellen Deutungen oder Erklärungen
☐ Raum für eigene Gedanken bleibt erhalten
👀 Unterschiedliche Perspektiven sichtbar machen
☐ Leise und laute Teilnehmende kommen gleichermaßen zu Wort
☐ Fragen fördern verschiedene Blickwinkel (z. B. Kundensicht, Zukunft, Konflikte)
☐ Beiträge werden gleichwertig behandelt
🧘 Mut zur Lücke
☐ Pausen und Denkzeiten werden zugelassen
☐ Nicht alles wird sofort zusammengefasst oder „rundgemacht“
☐ Spannung wird ausgehalten, wenn sie produktiv ist
🛠️ Reflexion statt Ritual
☐ Methode wird dem Thema und der Gruppe angepasst
☐ Struktur hilft – aber dominiert nicht
☐ Flexibilität ist erlaubt und gewollt
Fazit – Zwischen Steinen, Steuer und stillem Rückzug
LEGO SERIOUS PLAY kann ziemlich viel – wenn man’s richtig macht. Die Methode allein bringt aber noch keine Erkenntnis. Entscheidend ist, wer vorne steht (oder besser gesagt: nicht ständig im Mittelpunkt stehen will). Der Facilitator hat dabei eine besondere Rolle – irgendwo zwischen Leitung, Loslassen und einfach mal die Klappe halten.
Wenn’s gut läuft, entsteht ein Raum, in dem Leute anders denken, anders reden, anders reflektieren – und manchmal sogar anders zuhören als sonst. Dann kommen nicht nur bunte Modelle raus, sondern echte Aha-Momente.
Wenn’s schlecht läuft, wird’s ein Bastel-Zirkus mit Ablaufplan. Viel Methode, wenig Erkenntnis.
Die gute Nachricht: Es muss nicht schiefgehen.
Mit klaren Fragen. Mit einem guten Gespür für Timing. Und mit dem Mut, auch mal nicht alles zu erklären.
Am Ende gilt wie so oft: Kombiniert Handbuch und Hirn. Dann wird das auch was mit dem Denken – und nicht nur mit dem Bauen.
![LEGO Fahrzeug [Bild von Ulrike Mai auf Pixabay]](https://pierresmits.de/wp-content/uploads/2025/05/lego-476352_1280-1024x652.jpg)
Und nächste Woche?
Da schauen wir mal genauer hin. Es geht um das, was am Ende wirklich rauskommt. Um den ganzen Aufwand drumherum. Und um die Frage, ob die Wissenschaft beim Thema LEGO SERIOUS PLAY eher mit den Schultern zuckt.
Oder kurz gesagt: Bunte Steine, große Erwartungen – aber was bleibt eigentlich übrig? Mehr Schein als Sein?
Weiterführende und alternative Quellen
/01/ James, Alison: Learning in Three Dimensions: Using Lego Serious Play for Creative and Critical Reflection Across Time and Space, in: Prudence C. Layne/Peter Lake (Hrsg.), Global Innovation of Teaching and Learning in Higher Education, Springer eBook, 2015, [online] doi:10.1007/978-3-319-10482-9, S. 275–294.
/02/ Kristiansen, Per/Robert Rasmussen: Building a Better Business Using the Lego Serious Play Method, John Wiley & Sons, 21.07.2014.
/03/ LEGO®: LEGO® SERIOUS PLAY®: Open-source / Introduction to LEGO® SERIOUS PLAY®, o. D., [PDF] https://www.lego.com/cdn/cs/set/assets/blt8ec1d6ff766ddfd4/LEGO_SERIOUS_PLAY_OpenSource_14mb.pdf.
/04/ Nerantzi, Chrissi/Alison James: LEGO® for university learning: Online, offline and elsewhere, in: Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research), 10.12.2022, [online] doi:10.5281/zenodo.7421754.
/05/ Niedermayr, Melanie: Potenziale von ernsten Spielen für das Lernen Erwachsener: Eine Untersuchung der Methode LEGO Serious Play, Philipp Assinger (Hrsg.), , 08.2020, [online] https://unipub.uni-graz.at/obvugrhs/download/pdf/5734307?originalFilename=true.
/06/ Schleutker, Natascha: LEGO® Serious Play® im Projektmanagement – Wie Bausteine dabei helfen, innovative Lösungen zu finden, in: Parm AG, 22.02.2024, [online] https://parm.com/lego-serious-play-im-projektmanagement/.
/07/ Statler, Matt/Johan Roos/Bart Victor: Ain’t misbehavin’: taking play seriously in organizations, in: Journal Of Change Management, Bd. 9, Nr. 1, 01.03.2009, [online] doi:10.1080/14697010902727252, S. 87–107.
/08/ Stoehr, Anna-Elena: Was bringt LSP wirklich? Welche Vorteile und Nachteile hat LEGO® Serious Play®?, in: Anna-Elena Stoehr, 12.12.2023, [online] https://annaelenastoehr.com/welche-vorteile-und-nachreile-hat-lego-serious-play/.
/09/ t2informatik GmbH: LEGO Serious Play – t2informatik GmbH, in: T2informatik GmbH, 09.12.2024, [online] https://t2informatik.de/wissen-kompakt/lego-serious-play/.
Beiträge aus der LEGO-Mini-Serie
-
LEGO® SERIOUS PLAY® neu denken: Ist es im Unternehmensalltag eher hinderlich oder hilfreich?
Was bleibt von LEGO® SERIOUS PLAY®, wenn man ehrlich hinschaut?
-
Exklusion in der bunten Welt von LEGO® SERIOUS PLAY® – Wer darf mitspielen?
Warum die Methode mehr Barrieren aufbaut, als man auf den ersten Blick sieht.
-
LEGO® SERIOUS PLAY® im Business-Kontext – Spiel oder Ernst?
Innovativ oder kindisch?
-
LEGO® SERIOUS PLAY® – Mehr Schein als Sein?
Zwischen Aufwand und nachgewiesenem Nutzen
-
LEGO® SERIOUS PLAY® und die Macht des Facilitators – Worauf man achten muss
Wenn gute Moderation zum Nadelöhr wird – und wie man es besser machen kann
-
LEGO® SERIOUS PLAY® – Mehr Partizipation oder mehr Theater?
Wenn Beteiligung nur Fassade ist
-
Zwischen Methode und Mythos – Warum LEGO® SERIOUS PLAY® kritisch betrachtet werden muss
Das ist doch nur Spielen mit Klötzchen, oder?